
Kommunale Wärmeplanung
Schafft die kommunale Wärmeplanung die klimafreundliche Wärmewende?
Auf dem Weg zu einem klimaneutralen Deutschland ist der Ausbau der erneuerbaren Energien und damit die Energiewende ein unerlässlicher Schritt. So wurde die Energiewende bisher stark im Stromsektor vorangetrieben. Mit Blick auf den Endenergieverbrauch Deutschlands macht der Wärmesektor jedoch mehr als die Hälfte der verbrauchten Energie aus. Daher spielt für den Klimaschutz das kommunal betriebene Wärmenetz eine besondere Rolle.
- MEHR ERNEUERBARE ENERIGIEN IM WÄRMESEKTOR
- WIE FUNKTIONIERT KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG?
- ORIENTIERUNGSHILFE AUF DEM WEG ZUR WÄRMEWENDE
- ABLAUF DER KOMMUNALEN WÄRMEPLANUNG
- DER ERSTE SCHRITT - KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG
- SCHLÜSSELAKTEUR KOMMUNE
- VORTEILE DER KOMMUNALEN WÄRMEWENDE
- SIE HABEN FRAGEN ZUR WÄRMEPLANUNG?
- IMPULSFÖRDERUNG DER BMWK
- QUELLEN
- KONTAKT
MEHR ERNEUERBARE ENERIGIEN IM WÄRMESEKTOR
Auf dem Weg zu einem klimaneutralen Deutschland ist der Ausbau der erneuerbaren Energien und damit die Energiewende ein unerlässlicher Schritt. So wurde die Energiewende bisher überwiegend im Stromsektor vorangetrieben. Mit Blick auf den Endenergieverbrauch Deutschlands macht der Wärmesektor jedoch mehr als die Hälfte der verbrauchten Energie aus – 2020 waren es rund 52 %. Während der erneuerbare Anteil im Stromsektor zuletzt kontinuierlich anstieg, kam man Wärmesektor lange Zeit nicht über rund 14 % erneuerbaren Anteil hinaus. Das ändert sich erst seit 2018 langsam unter anderem auch durch die Sektorenkopplung. Hierbei verschmelzen die Bereiche Strom, Wärme und Verkehr immer mehr in Bezug auf die genutzten Energieträger. Energieffiziente Fernwärme- oder Nahwärmenetze als Bestandteil der kommunalen Energieversorgung rücken immer stärker in den Fokus heimischen Städteplanung.
WIE FUNKTIONIERT KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG?
Die Energiewende im Wärmebereich erfordert den Einsatz großer Mengen nachhaltiger Energiequellen in Kommunen und geht daher oft mit einer Umstellung auf eine netzgebundene Wärmeversorgung einher. Diese Art der Wärmeverteilung, oft bezeichnet als Fernwärme- oder Nahwärmenetz ermöglicht die Einbindung einer Vielzahl von Wärmequellen. Dies kann Wärme aus Solarthermie, Biomasse und verschiedenen Umwelt-Wärmequellen sein, aber auch Abwärme aus industriellen Prozessen und ähnlichen Quellen. Über Wärmepumpen lassen sich beispielsweise Abwasserströme von Kläranlagen oder aus der Kanalisation, oberflächennahe Geothermie, Oberflächengewässer sowie Aquifere (grundwasserführende Gesteinsschicht) als Wärmequellen nutzen. Neben der Umstellung der Wärmeerzeugung und -Verteilung muss auch der Wärmebedarf der Gebäude gesenkt sowie die Energieeffizienz von Prozessen gesteigert werden. Dazu sind beispielsweise Programme zur Gebäudesanierung von Privathaushalten oder Maßnahmen zum Energiemanagement in Unternehmen wichtig.
ORIENTIERUNGSHILFE AUF DEM WEG ZUR WÄRMEWENDE
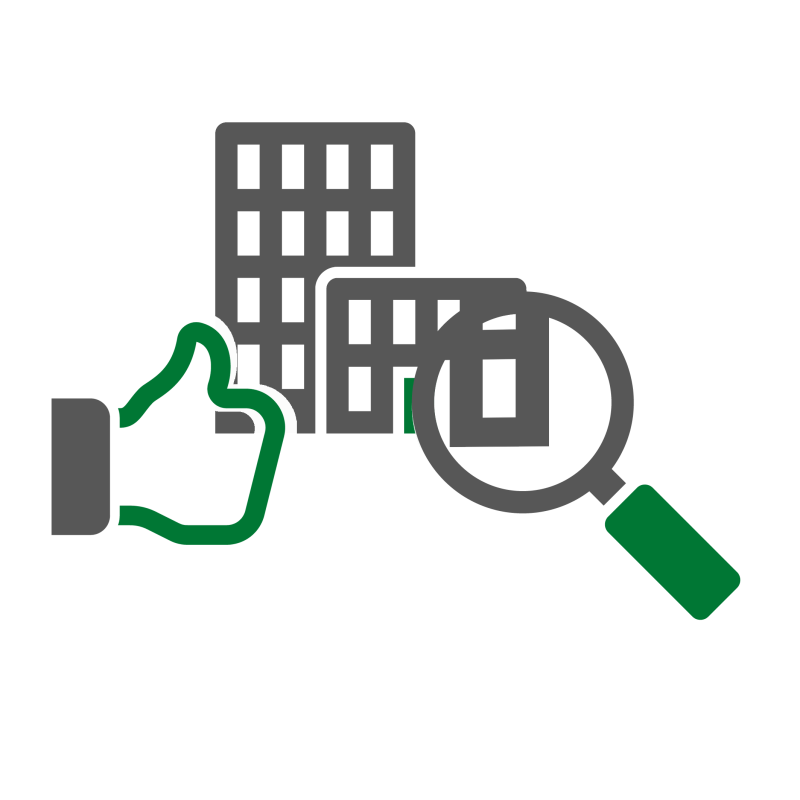
Es gibt also eine Vielzahl an Möglichkeiten für nachhaltige Energieträger, deren Einbindung in ein sinnvolles System komplex ist und einen nicht unerheblichen Koordinationsaufwand bedeutet. Hier ist der kommunale Wärmeplan das richtige Werkzeug für ein strategisches, effizientes und koordiniertes Vorgehen, mit dem Kommunen die Energiewende voranbringen können.
ABLAUF DER KOMMUNALEN WÄRMEPLANUNG
Strukturierter Ablauf der kommunalen Wärmeplanung
- Bestandsanalyse
- Potenzialanalyse
- Aufstellung des kommunalen Zielszenario
- Strategische Ausarbeitung der Wärmewende
DER ERSTE SCHRITT - KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG
Gesetzlich gefordert wird ein im Rahmen der Wärmeplanung erstellter umfassender Maßnahmenplan zur nachhaltigen Wärmeversorgung. Im ersten Schritt wird eine umfangreiche Analyse der Ist-Situation in der Kommune vorgenommen, um den aktuellen Wärmebedarf und -verbrauch sowie die daraus resultierenden Treibhausgas-Emissionen zu ermitteln. Dabei wird Kartenmaterial zusammengetragen und bspw. über eine Geoinformations-Software (kurz GIS) mit weiteren Daten angereichert und sinnvoll visuell ausgewertet.
Darauf aufbauend werden im zweiten Schritt weitere Daten zu Potenzialen der Energieeinsparung für Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme ermittelt. Ebenso werden die lokal verfügbaren Potenziale erneuerbarer Energien und Abwärme erhoben und unter anderem in kartografischer Form mit den Daten der Bestandsanalyse zusammengeführt.
Anschließend wird ein Szenario zur Deckung des zukünftigen Energiebedarfs mit erneuerbaren Energien erstellt. Dabei werden Eignungsgebiete für Wärmenetze und Einzelversorgung ermittelt und Zwischenziele der künftigen Versorgungsstruktur aufgezeigt.
Die Wärmewendestrategie formuliert abschließend einen Transformationspfad zur Umsetzung des Wärmeplans. Dies beinhaltet ausgearbeitete Maßnahmen, Umsetzungsprioritäten und einen Zeitplan für die nächsten Jahre. Eine Fortschreibung des kommunalen Wärmeplans in regelmäßigen Abständen sichert die optimale Umsetzung dieses Transformationsprozesses.
SCHLÜSSELAKTEUR KOMMUNE
Um die Wende im Wärmesektor erfolgreich voranzubringen, kommt der Kommune eine wichtige Schlüsselrolle zu. Sie tritt als Initiatorin, Koordinatorin und Unterstützerin auf und setzt wichtige Rahmenbedingungen. Auch die Vorbildfunktion der Kommune spielt eine wichtige Rolle. Für eine erfolgreiche Transformation ist eine klare gesetzliche Regelung erforderlich. Ebenso müssen viele Gespräche mit Unternehmen und Bürgern geführt werden und viele Akteure an einen Tisch gebracht werden. Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung sind hier wichtige kommunale Aufgaben.
VORTEILE DER KOMMUNALEN WÄRMEWENDE
- Macht unabhängig von fossilen Energieimporten
- Reduziert Treibhausgasemissionen für effektiven Klimaschutz
- Hilft nachhaltig dabei, den Wärmebedarf von Haushalten sowie Gewerbe und Industrie klimaneutral zu gestalten
- Verbessert die regionale Wertschöpfung, schafft Arbeitsplätze und generiert Steuereinnahmen
- Ermöglicht längerfristig planbare Wärmekosten durch brennstofffreie Energieerzeugung
SIE HABEN FRAGEN ZUR WÄRMEPLANUNG?
Unsere Erfahrung aus dem Bereich Energieeffizienz im Gebäudebestand und bei der Konzeption von Neubauten und deren Energieversorgung sind wichtige Informationen für die globale Betrachtung.
Der Blick über das einzelne Gebäude hinaus lässt dabei eine holistische Betrachtung der Wärmeversorgung zu. Dies kann zu einer höheren Gesamteffizienz und einem höheren Gesamtnutzen für die Gemeinschaft führen. Mit dieser Grundlage werden weitere Möglichkeiten eröffnet, wie eine Kommune als Gesamtsystem betrachtet und klimaneutral entwickelt werden kann.
IMPULSFÖRDERUNG DER BMWK
- Förderung existiert seit November 2022 mit verbesserten Förderkonditionen für kommunale Wärmepläne
- Das Angebot der Förderung gilt bis Ende 2023 (Stand Juli 2023)
- Finanzschwache Gemeinden können eine Vollfinanzierung erhalten
- Erhöhte Förderquoten bis zu 90 % und 100 % für finanzschwache Kommunen
- Richtlinie bietet verschiedene Fördermöglichkeiten, von Beratung bis zu investiven Maßnahmen
- Anträge können ganjährig gestellt werden
QUELLEN
KONTAKT





